Die Landesfarben von Braunschweig waren, außer zwischen 1814 und 1831, Blau und Gelb. Der Ursprung dürfte auf das verminderte dänische Wappen zurückgehen, das Anfang des 13. Jahrhunderts Bestandteil des Wappens der Herzöge wurde: blauer Löwe auf goldenem, mit roten Herzen besähtem Grund. Zwischen 1814 und 1831 waren die Landesfarben Blau und Weiß. Der Grund dafür ist nicht bekannt.
Die Flagge des Herzogs zeigte die Heraldik der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg im Geviert, und war ab 1914, als wieder ein Welfe den Thron bestieg, in der Mitte mit dessen Wappen belegt. Es lässt die Abstammung aus der Linie Kurbraunschweig (Haus Hannover) erkennen.
Das weiße Pferd in der Kartusche in der Mitte der ab 1912 verwendeten Dienstflagge ist das "Sachsenross". Es geht auf das Stammesherzogtum Sachsen zurück, und wurde 1361 von den Welfen übernommen, der seit 1142 regierenden Dynastie. Das "Sachsenross" wurde 1814 zum Wappentier des Königreichs Hannover (ab 1866 preußische Provinz Hannover), der preußischen Provinz Westfalen, und ab 1922 des Freistaats Braunschweig. In der BRD wird diese Tradition fortgesetzt, in dem jene Bundesländer der BRD, zu denen ehemals welfische Gebiete gehören, noch heute das weiße Pferd im Wappen haben: Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.
Ein für die Flagge bedeutsames Ereignis war die Machtergreifung durch die Nationalsozialisten im Deutschen Reich im Jahre 1933. Alle offiziellen Nicht-Hakenkreuz-Flaggen die auf den Föderalismus, regionale Bezüge oder das Kaiserreich zurückgingen wurden zwischen 1933 und 1935 abgeschafft. Für die Nationalsozialisten galten die föderale Struktur des Deutschen Reiches, seine historisch gewachsenen Länder, als überholt, als Relikte einer zu überwindenenden Vergangenheit. In diesem Sinne wurden mehrere Gesetze erlassen, am 31.03.1933 das 'Vorläufige Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich', am 07.04.1933 das 'Zweite Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich' und schließlich, am 30.01.1934 das 'Gesetz über den Neuaufbau des Reiches'. Die föderale Länder-Struktur des Deutschen Reiches wurde damit durch die Gaue der NSDAP abgelöst, die Länder wurden bedeutungslos. Ämter und Behörden hatten ab jetzt die Hakenkreuzflagge als Dienstflagge zu verwenden, und zwar bis zum 15. September 1935, als mit dem Reichsflaggengesetz eine Dienstflagge für alle Ämter und Behörden des Reiches geschaffen wurde. Die Ministerpräsidenten der Länder, ab spätestens 1933 alle von der NSDAP – und dann meist Reichsstatthalter genannt – blieben jedoch bis 1945 im Amt. Die entsprechenden Landesfarben galten mit Einschränkungen zwar weiter, auf jeden Fall aber nicht in Form von Flaggen. Sie wurden z.B. vereinzelt an Uniformen der SA oder bei bestimmten Dienstgraden der Hitlerjugend in der Brustschnur verwendet.
Nach dem Krieg wurde die Verwaltung innerhalb des Deutschen Reiches neu aufgebaut, und zwar lokal, über die Struktur der Länder. Das waren teilweise alte Länder, teilweise wurden neue Länder geschaffen. Dabei besann man sich oft der alten Landesfarben und reaktivierte sie – oder man schuf neue – für eingeschränkte hoheitliche Aufgaben, die der Kontrolle durch die Alliierten unterstanden. Mit der Gründung der BRD und der DDR wurde für beide Gebilde eine interne Länderstruktur final festgelegt und es wurden entsprechende offizielle Flaggen für die Länder eingeführt. Braunschweig gehört heute größtenteils zum Bundesland Niedersachsen, einige Gebiete gehören zu Sachsen-Anhalt.
Quelle/Source: Volker Preuß, Jürgen Kaltschmitt, Uniform-Fibel

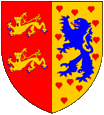
1235–1269,
Wappen Herzogtum Braunschweig-Lüneburg
Quelle/Source: nach/by: Wikipedia (D)
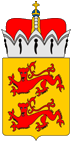
1269–1291,
Wappen Fürstentum Braunschweig,
Quelle/Source: nach/by: Wikipedia (D)
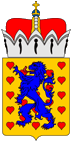
1269–1705,
Wappen Fürstentum Lüneburg,
Quelle/Source: nach/by Heraldique Europeenne
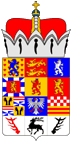
18. Jhd.,
mittleres Wappen,
Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel
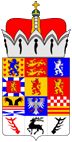
1667–1735,
mittleres Wappen
Fürstentum Braunschweig-Bevern,
Quelle/Source: hier klicken/click here
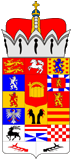
1692–1810,
mittleres Wappen,
Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg,
ab 1814, Königreich Hannover,
Quelle/Source: nach/by: Wikipedia (D)
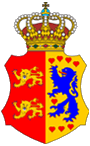
1814–1918,
kleines Wappen Herzogtum Braunschweig,
Quelle/Source: nach/by: Wikipedia (D), Volker Preuß
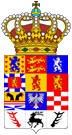
1814–1918,
mittleres Wappen,
Herzogtum Braunschweig,
Quelle/Source: nach/by: Wikipedia (D)
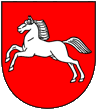
1922–1946,
Wappen Freistaat Braunschweig,
Quelle/Source: nach/by Wikipedia (D)

Die Heraldik Braunschweigs war von der herrschenden Dynastie der Welfen bestimmt. Die Welfen waren zunächst Grafen in Bayern (Graf Welf, Anfang des 9. Jahrhunderts), später auch Könige von Oberburgund (10. Jahrhundert), Herzöge von Kärnten und Markgrafen von Verona (11. Jahrhundert), und wurden 1070 die Herzöge von Bayern. Im Jahre 1120 wurde Heinrich der Stolze durch Erbschaft auch Herzog von Sachsen. Heinrich der Löwe erhält 1142 Braunschweig und das Herzogtum Sachsen zum Lehen, und 1154 wird er auch Herzog von Bayern. Im Konflikt mit dem Staufischen Kaiser wird 1180 über Heinrich die Reichsacht verhängt. In den folgenden Kämpfen unterliegt Heinrich und verliert große Teile seiner Besitzungen. Das Herzogtum Sachsen wurde geteilt. Der Westen kam als Herzogtum Westfalen an das Erzbistum Köln, der Osten als Herzogtum Sachsen an das Haus Askanien. Heinrich der Löwe behält den zentralen Teil als Herzogtum Braunschweig-Lüneburg. Nach Erbteilungen entstanden aus dem Herzogtum Sachsen der Askanier im Jahre 1296 die Herzogtümer Sachsen-Lauenburg und Sachsen-Wittenberg. Im Jahre 1356 (Goldene Bulle) wurde Sachsen-Wittenberg zum Kurfürstentum Sachsen erhoben. Nachdem die sächsischen Askanier 1422 ausgestorben waren, kam das Herzogtum und die Kurwürde 1423 an die Wettiner, die Markgrafen von Meißen und es entstand das heutige Sachsen (Obersachsen).
Ein wichtiges Symbol der (Nieder-)Sachsen und auch der Welfen ist das "Sachsenross", ein weißes Pferd auf rotem Grund. Es galt von alters her als das Zeichen des Herzogs Widukind, der im 8. Jahrhundert Sachsen gegen die Franken verteidigte. Im Kampf gegen die Franken wurde das "Sachsenross" schnell zum legendären Symbol aller Sachsen. Dieses Zeichen wurde von den Welfen im Jahr 1361 in ihre Heraldik aufgenommen. So wurde es zum Wappentier des Königreichs Hannover (ab 1866 preußische Provinz Hannover), der preußischen Provinz Westfalen und ab 1922 des Landes Braunschweig. In der BRD wird diese Tradition fortgesetzt, in dem jene Bundesländer der BRD, zu denen ehemals welfische Gebiete gehören, noch heute das weiße Pferd im Wappen haben: Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Auf alten Wappendarstellungen (mindestens bis 1945) trägt das Sachsenross den Schweif immer nach oben gerichtet. Mit der Neugründung des Staates Hannover wurde nach dem Zweiten Weltkrieg mit dieser Tradition gebrochen, denn das Sachsenross trug auf dessen Flagge einen eher herabhängenden Schweif. Das wurde für das Land Niedersachsen – dem Nachfolger des Staates Hannover – beibehalten. Daher wird das Sachsenross in Westfalen, wo es den Schweif noch immer noch oben gerichtet trägt, als "Westfalenpferd" bezeichnet, im Gegensatz zum "Niedersachsenpferd".
Der Welfe Heinrich der Löwe, eigentlich Heinrich XII., heiratete 1168 Mathilde, die Tochter des Königs von England aus dem Hause Anjou-Plantagenet. Im Jahre 1184 wurde, als fünftes Kind dieser Ehe, Wilhelm "Langschwert"geboren, der Herzog von Lüneburg. Er führte das mütterliche, englische Wappen in verminderter Form. Es zeigte nur noch zwei goldene Löwen (anstelle von drei) auf rotem Grund. Dieses Symbol hat als Zeichen welfischer Heraldik alle Zeiten überdauert. Wilhelm "Langschwert" heiratete 1202 Helene, die Tochter des Königs von Dänemark. Im Jahre 1204 wurde Otto I. "das Kind", Herzog von Braunschweig-Lüneburg, geboren. Er führte als Wappen das mütterliche, dänische Wappen in verminderter Form: zwei blaue Löwen (anstelle von drei) im goldenen, mit roten Herzen bestreuten Feld. Der Sohn Ottos I., Albrecht I. "der Große", 1279 geboren, Herzog von Braunschweig-Lüneburg, führte den verminderten englischen Wappenschild mit zwei goldenen Löwen auf rotem Grund. Der Enkel von Albrecht I., Magnus I. "der Fromme", 1369 geboren, Herzog von Braunschw.-Lüneburg, kombinierte auf seinem Wappen die beiden englischen Löwen mit einem der dänischen Löwen. Damit hatte das Wappen der Herzöge von Braunschweig seine letzte Form erhalten: Blasonierung, kleines Wappen, Herzogtum Braunschweig: "gespalten, rechts in Rot zwei schreitende, blaubewehrte, leopardierte goldene Löwen mit ausgeschlagenen blauen Zungen übereinander, links in mit roten Herzen besätem goldenen Feld, ein rotbewehrter, blauer Löwe mit ausgeschlagener roter Zunge."
Die Schilde der großen Wappen sind sehr reich gegliedert und zeigen viele Felder, die Heroldsstücke der Familienlinien oder territoriale Erwerbungen widerspiegeln. Manchmal wurde im Wappen noch ein roter Herzschild gezeigt, der das "Sachsenross" zeigte.
Quelle/Source Ronald Preuß, Volker Preuß, Deutsche Staatenkunde - Band 2,
www.niedersachsen.de

Lesen Sie hier:
Hintergründe, Geschichte und Fakten zum Thema "Der Löwe in der Heraldik". Ausführungen, Varianten, Entwicklung, sowie Panther und Leoparden.



bis 1815(?),
Kokarde von Braunschweig

bis 1919,
Kokarde von Braunschweig
In der napoleonischen Zeit war die Kokarde des Landes einfarbig schwarz, vermutlich bis 1815, so wie im ebenfalls von den Welfen regierten Hannover. Über die Färbung und Gestaltung der Kokarden zwischen dem Ende der Napoleonischen Ära und dem Ende der Monarchie im Jahre 1918 ist den Autoren nichts genaueres bekannt.
Quelle/Source: Jürgen Kaltschmitt, nach
1) O. v. Pivka/M. Roffe, "The black Brunswickers" (früher Osprey-Men-at-Arms-Band - OHNE Nummerierung), Oxford 1973
2) O. v. Pivka/B. Fosten, "Brunswick Troops 1809-1815" (Band 167 der Men-at-Arms-Reihe), Osprey, London 1985

Lesen Sie hier:
Hintergründe, Geschichte und Fakten zum Thema "Kokarden".

Kokarde

Die Aufspaltung der Welfen in verschiedene Linien führte zwar ab 1269 zur Teilung des Landes in verschiedene Fürstentümer, jedoch blieb das Herzogtum als Ganzes bis 1810 erhalten. Jeder der Fürsten, z.b. der Fürst von Grubenhagen, war zugleich Herzog von Braunschweig-Lüneburg. In den Jahren 1814/1815 wurde auf dem Wiener Kongress die Neuordnung Europas nach der Ära Napoléon beschlossen. Das Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel wird unter Herzog Friedrich Wilhelm als Herzogtum Braunschweig wieder hergestellt und besteht bis 1918. Die Linie der Welfen von Braunschweig-Wolfenbüttel stirbt im Jahre 1884 aus.
Andere Linien des Herzogtums waren ab 1291 ebenfalls territorial souverän: die Fürstentümer Calenberg, Göttingen, Grubenhagen und Lüneburg (ab 1261). Das Fürstentum Grubenhagen wurde 1617 an Lüneburg vererbt, Calenberg und Göttingen vereinigten sich 1495 zum Fürstentum Calenberg-Göttingen, und dieses Fürstentum wurde 1692 zum Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg erhoben. Das Fürstentum Lüneburg ging 1705 an das Kurfürstentum. Das Kurfürstentum, und damit das Herzogtum Braunschweig-Lüneburg, endete 1810 vorübergehend als es dem Königreich Westphalen angeschlossen wurde. Auf dem Wiener Kongress wurde das Kurfürstentum wieder hergestellt und zum Königreich Hannover erhoben, das aber 1866 endete als es als Provinz dem Königreich Preußen eingegliedert wurde. Die Welfen der Linie Braunschweig-Lüneburg besteigen im Jahre 1913 den Thron des Herzogtums Braunschweig, und regieren bis 1918.
Quelle/Source: nach/by Wikipedia (D),
Volker Preuß

Die Bundesstaaten des Deutschen Reiches 1871 bis 1920:
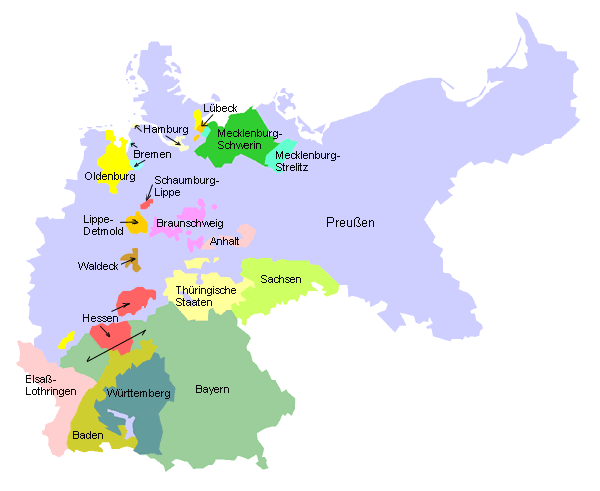
Quelle/Source: Volker Preuß

Fläche: 3.672 km²
Einwohner: 495.000 (1910)
Bevölkerungsdichte: 135 Ew./km²
Hauptstadt: Braunschweig
Währung bis 1868: 1 Taler = 24 Groschen = 288 Pfennige
Währung 1868–1871: 1 Taler = 30 Silbergroschen = 300 Pfg.
Währung 1871–1924: 1 Mark = 100 Pfennig
Währung 1924–1946: 1 Reichsmark (RM) = 100 Reichspfennig (Rpf.)
Quelle/Source:
Wikipedia (D),
Der Michel,
Volker Preuß

1142 · Heinrich der Löwe aus dem Haus der Welfen erhält Braunschweig und das Herzogtum Sachsen zum Lehen
1154 · Heinrich der Löwe wird Herzog von Bayern
1180 · im Konflikt mit dem Staufischen Kaiser wird über Heinrich die Reichsacht verhängt, in den folgenden Kämpfen unterliegt Heinrich und verliert alle Besitzungen (auch Bayern), außer Braunschweig und Lüneburg und einige sehr kleine Gebiete, Herzog von Sachsen wird der Askanier Bernhard I. von Anhalt
1235 · Otto das Kind überträgt all seinen Besitz zurück an den Kaiser, diese werden als Herzogtum Braunschweig zusammengefasst und Heinrich, als Herzog von Braunschweig, wieder übertragen
1269 · das Herzogtum Braunschweig wird in das Fürstentum Braunschweig und das Fürstentum Lüneburg aufgeteilt, bleibt jedoch formell als Herzogtum Braunschweig-Lüneburg bestehen
1291 · in Folge weiterer Teilungen entstehen unter anderem das Fürstentum Calenberg-Göttingen und das Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel, die braunschweigischen Fürstentümer (außer Braunschweig-Wolfenbüttel) werden in den Folgejahren vereinigt, und bilden ab 1692 das Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg (auch: Kurfürstentum Hannover)
1792, 1796, 1800 und 1805 · Invasionen französischer Revolutionstruppen unter Napoléon in das Deutsche Reich, das Deutsche Reich unterliegt und wird von Napoléon territorial umgestaltet: geistliche Besitzungen werden enteignet, alte Fürstenterritorien aufgehoben und alten oder neuen Fürstentümern übertragen
01.08.1806 · das Heilige Römische Reich Deutscher Nation endet
1807 · Napoléon bildet das Königreich Westphalen unter seinem Bruder Jérôme, dem neben braunschweigischen, preußischen und hessischen, ab 1810 auch das ganze Kurfürstentum Hannover angeschlossen wurden, das Herzogtum Braunschweig endet
1813 · Niederlage Napoléons bei Leipzig im Oktober
1814–1815 · Wiener Kongress, Neuordnung Europas nach der Ära Napoléon, das Herzogtum Braunschweig wird unter Herzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig-Wolfenbüttel wieder hergestellt, Braunschweig tritt dem Deutschen Bund bei
1830 · Aufstand, Herzog Karl II. flieht in die Schweiz, neuer Herzog wird sein Bruder Wilhelm
1834 · Zollunion mit Hannover
1841 · Beitritt zum Deutschen Zollverein
1866 · Bruderkrieg Preußens gegen Österreich, Braunschweig steht auf der Seite Preußens, das den Krieg gewinnt
1871 · Beitritt zum Deutschen Reich
1884 · Tod von Herzog Wilhelm, Aussterben der Linie Braunschweig-Wolfenbüttel, nach der Erbfolge hätte Ernst August von Hannover (eigentlich Braunschweig-Lüneburg), Herzog von Cumberland, den Thron besteigen sollen, aber Hannover und seine Welfische Dynastie war einer der mächtigsten Feinde Preußens im Bruderkrieg von 1866 gewesen, Preußen siegte zwar in diesem Krieg, das Königreich Hannover war von Preußen beendet und als Provinz eingegliedert worden, jedoch wollte Preußen keine neue Hannoversche Dynastie auf einem deutschen Thron sehen
02.11.1885 · Bundesratsbeschluss: die Thronfolge geht an Prinz Albrecht von Preußen als Regenten
1906 · Tod von Prinz Albrecht
05.06.1907 · Bundesratsbeschluss: die Thronfolge geht an Johann Albrecht, dem Herzog von Mecklenburg als Regenten
24.05.1913 · Ernst August von Hannover, Sohn von Ernst August Herzog von Cumberland, heiratet Prinzessin Viktoria Luise von Preußen, Versöhnung zwischen Hannover und Preußen
27.11.1913 · der Herzog von Cumberland verzichtet auf sein Ansprüche auf den Thron von Braunschweig
28.11.1913 · Bundesratsbeschluss: die Thronfolge geht an Ernst August von Hannover aus der Linie Braunschweig-Lüneburg (Herzog von Braunschweig, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, Prinz von Hannover)
01.11.1913 · Einzug des Herrscherpaares in Braunschweig
08.11.1918 · Sturz der Monarchie
10.11.1918 · Proklamation der Sozialistischen Republik Braunschweig
06.01.1922 · Proklamation des Freistaats Braunschweig
1934 · die territoriale Länder-Struktur des Deutschen Reiches wird durch die Gaue der NSDAP abgelöst, die Länder werden bedeutungslos
1945 · Braunschweig wird Teil der britischen und Teil der sowjetischen Besatzungszone
Juli 1945 · die sowjetisch besetzten Gebiete von Braunschweig werden dem neu gebildeten Land Provinz Sachsen-Anhalt angegliedert
23.11.1946 · die britische Militärregierung veranlasst die Vereinigung des Landes Braunschweig (britsch besetzte Gebiete) mit Hannover, Oldenburg und Schaumburg-Lippe zum Land Niedersachsen
Quelle/Source: Atlas zur Geschichte,
Wikipedia (D)

Der Name "Braunschweig" besteht aus zwei Teilen. Die erste Silbe "braun" geht auf den Namen "Bruno" zurück, die zweite Silbe "schweig" bezieht sich auf das lateinische Wort "vicus", was übersetzt "Ort" heißt. Braunschweig ist "Brunos Stadt".
Quelle/Source: Handbuch der geographischen Namen

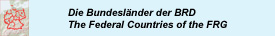

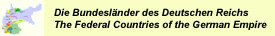

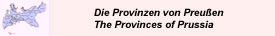

Mit freundlicher Untersützung von: A. Kortmann (D)
![]()










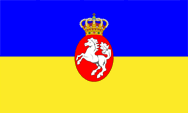


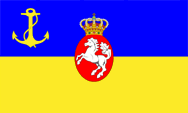


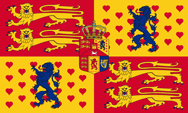


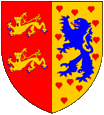
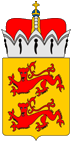
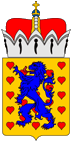
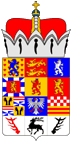
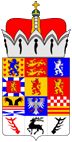
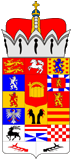
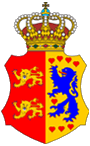
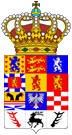
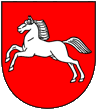




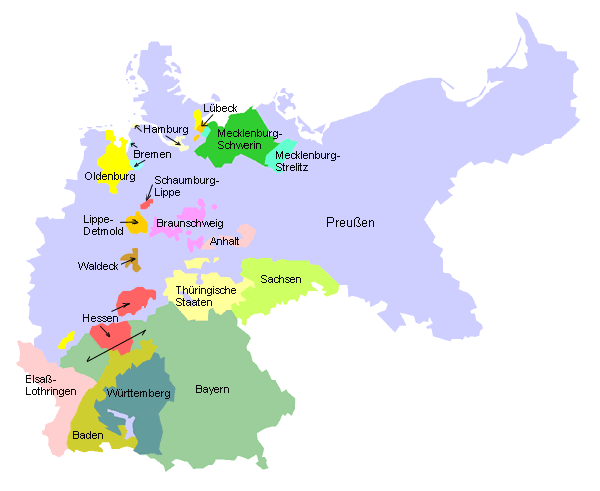
![]()
